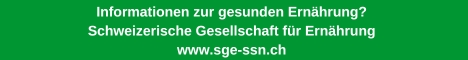Home
Reports
News, Tipps, …
Suche & Archiv
Die besten Events
Werbung
Über uns
Impressum
Datenschutz
Tipp
23.06.2025
BUCHTIPP: Weber's Steak
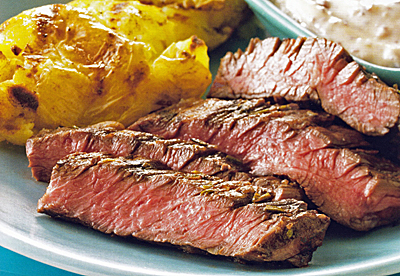
Grill-Experte Jamie Purviance beschreibt 60 Steak-Grillrezepte aus aller Welt. Mit Tabellen zur Garzeit und Leseprobe zum Gargrad-Test.
BUCHTIPP: Weber's Steak
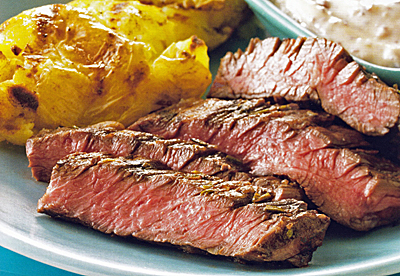
Grill-Experte Jamie Purviance beschreibt 60 Steak-Grillrezepte aus aller Welt. Mit Tabellen zur Garzeit und Leseprobe zum Gargrad-Test.
News, Tipps, …
Druckansicht10.12.2022
Vision Landwirtschaft hat in einer Studie untersuchen lassen, wie die Politik sieben verschiedene Ernährungsstile – von «vegan» bis «fleischbetont» – indirekt unterstützt. Fazit: Die Nahrungsmittel der verschiedenen Ernährungsstile werden sehr ungleich unterstützt. Per Saldo werden mehrere hundert Franken pro Person und Jahr von «veganen» und «umweltoptimierten» zu «protein- und fleischbetonten» Ernährungsstilen umverteilt.
Vor zwei Jahren hat der Verein Vision Landwirtschaft, eine Denkwerkstatt unabhängiger Landwirtschaftsexperten, die Kosten (Vollkosten) und Kostenträger (Konsument:innen, Steuerzahler:innen, Allgemeinheit) der Schweizer Nahrungsmittel beziffert. Es zeigte sich: Verursachergerechtigkeit oder Kostenwahrheit liegen in weiter Ferne, auch im Vergleich mit anderen Politikbereichen.
Nach weiteren Temperatur-Rekorden bleibt das Thema Ernährung aktuell. Immer öfter hört man, dass der Schlüssel zur Lösung von Umweltproblemen bei Ernährungsstilen zu suchen ist. Kürzlich hat auch der Direktor des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) darauf hingewiesen. Was tut die Agrarpolitik in dieser Hinsicht?
In einer neuen Studie hat Vision Landwirtschaft untersucht, wie die Politik verschiedene Konsumstile finanziell unterstützt oder belastet – anregt oder entmutigt. Berücksichtigt wurden wie schon in der Studie von 2020 die Beiträge des Bundes für die Nahrungsmittelproduktion und die ungedeckten Kosten zulasten der Allgemeinheit (externe Kosten von Umweltauswirkungen der Produktion).
Die Berechnungen wurden von der Basler Beratungsfirma BSS im Auftrag von Vision Landwirtschaft durchgeführt und von der Kalaidos Fachhochschule Schweiz begleitet. Datengrundlage sind Ökobilanzzahlen für Nahrungsmittel und Ernährungsstile der Firma ESU-Services und (aktualisierte) Kostenschätzungen der Studie «Kosten und Finanzierung der Landwirtschaft» von Vision Landwirtschaft.
Verglichen wurden die indirekten Kosten von sieben Ernährungsstilen:
●vegan keine tierischen Produkte)
●ovo-lacto-vegetarisch (nur pflanzliche Nahrungsmittel, Eier, Honig, Milchprodukte)
●ovo-lacto-pescetarisch (nur pflanzliche Nahrungsmittel, Eier, Honig, Milchprodukte, Fisch)
●flexitarisch (gemässigter Fleischkonsum, Milchprodukte, Eier)
●proteinbetont (hoher Konsum von Fleisch, Milchprodukten und Eiern)
●fleischbetont (sehr hoher Fleischkonsum)
●umweltoptimiert (basierend auf der Schweizer Lebensmittelpyramide und Empfehlungen zum nachhaltigen Essen und Trinken FOODprints®)
Beiträge der Steuerzahlenden und Umweltkosten
Die Beiträge des Bundes an die Nahrungsmittelproduktion betrugen im Jahr 2020 rund 300 Franken pro Person. Im diesem Umfang wurden also die durchschnittlich konsumierten Nahrungsmittel unterstützt. In die Nahrungsmittel des veganen Ernährungsstils flossen pro Person und Jahr rund 50 Franken. Demgegenüber flossen 500 Franken pro Person in die Nahrungsmittel der Ernährungsstile «proteinbetont» und «fleischbetont» (Abbildung, hellgelber Bereich der Balken).
Die von der Politik in Kauf genommenen und nicht den Verursachern angelasteten Kosten zulasten der Allgemeinheit (externe Kosten) beliefen sich im Jahr 2020 auf durchschnittlich 800 Franken pro Person. Dabei wiesen die Ernährungsstile «umweltoptimiert» und «vegan» mit 450 bzw. 500 Franken pro Person die tiefsten, die Ernährungsstile «proteinbetont» und «fleischbetont» mit je 1050 Franken die höchsten externen Kosten auf.
Wenn beim Fleisch auch bescheidene (Hackfleisch, Innereien) und weniger bescheidene Ernährungsstile (hochpreisige Fleischstücke) unterschieden werden, gehen die Zahlen noch stärker auseinander. Am stärksten gefördert wurden– wenig erstaunlich – luxuriöse fleisch- betonte Ernährungsstile mit Beiträgen pro Person im Jahr 2020 im Bereich von 2500 Franken.
Weitergehende Berechnungen zeigen auf, wie in der Schweiz über Nahrungsmittelsubventionen indirekt Einkommen umverteilt werden – wie viel also per Saldo beispielsweise von veganen hin zu fleischbetonten Ernährungsstilen umverteilt wird.
Blick auf das Gesamtsystem
Heute wird im Zusammenhang mit der Agrarpolitik gerne auf das Gesamtsystem verwiesen. Die Umweltkosten der Landwirtschaft werden dabei zum Problem der Konsumentinnen und Konsumenten gemacht. So auch in einem Interview des Tagesanzeigers mit Christan Hofer, Direktor des Bundesamts für Landwirtschaft.
Tagesanzeiger: Wie wollen Sie die Landwirtschaft dazu bringen, weniger tierische und dafür mehr menschliche Nahrungsmittel zu produzieren? BLW-Direktor Christian Hofer: Die Veränderung wird über die Nachfrage kommen – der Konsum muss sich in erster Linie ändern. […] Wenn wir die Tierproduktion in der Schweiz herunterfahren, importieren wir einfach mehr und exportieren die Emissionen. Diese Erzählung kennen wir auch von den Lobbyisten der Agrarindustrie. Sie ist in hohem Mass irreführend. Die Zahlen zeigen: Die Massnahmen des Bundes behindern die Entwicklung hin zu nachhaltigeren Ernährungsstilen. Trotz allen schönen Worten: der Bund sorgt weiterhin dafür, dass diejenigen, die sich um eine nachhaltige Ernährung bemühen, finanziell benachteiligt werden.
Bevorzugte und weniger bevorzugte Ernährungsweisen
Die Politik wirkt dabei nicht nur über die Preise, sondern auch subtiler, auf psychologischer und moralischer Ebene. Der Bund macht mit seinen Fleisch- und Tiersubventionen und Werbung für «Schweizer Fleisch» eine Rundum-Versorgung für fleischbetonte Ernährung: Er sorgt für tiefe Preise, ein gutes Gewissen und patriotisch gefärbte staatliche Anerkennung. Die Aussage: «Wenn wir die Tierproduktion in der Schweiz herunterfahren, importieren wir einfach mehr und exportieren die Emissionen», ist deshalb höchstens halbwahr.
Die Werbung für «Schweizer Fleisch» ist der beste Beleg dafür. Diese Werbung ist nur rational zu erklären, wenn das «gute Gewissen» den Fleischkonsum insgesamt fördert. Warum lässt sich das sagen? Weil die Anteile Fleisch aus dem In- und Ausland nicht von der Wahl der Konsumentinnen und Konsumenten abhängen, sondern vom Gesamtkonsum. Dafür sorgen die Importkontingente. Wenn man die Produktion von Schweizer Fleisch steigern will, muss man den Konsum von Fleisch insgesamt steigern. Genau das macht die Werbung mit dem guten Gewissen. Die Werber zielen auf eine Stärkung der Nachfrage nach Fleisch insgesamt – anders als Proviande und der Bundesrat uns glauben machen wollen.
Zudem würden die Emissionen auch bei gleichbleibendem Konsum nur teilweise exportiert, aus zwei Gründen: Erstens, weil die Produktion in der Schweiz bereits intensiver und deshalb – insbesondere bei den Umweltbelastungen mit Stickstoff – umweltschädlicher ist als in vielen Herkunftsländern von Importen. Zweitens, weil die Schweiz weit dichter besiedelt ist. Die Umweltkosten zusätzlicher Produktion sind in der Schweiz deshalb besonders hoch. Auch die frühere Einsicht, dass der Selbstversorgungsgrad kein gutes Mass für Versorgungssicherheit ist, ging beim BLW wieder vergessen.
Zum Schluss noch einmal Christian Hofer: «Wir prüfen derzeit, ob es in der heutigen Agrarpolitik immer noch Fehlanreize gibt. […] Aber wie bereits gesagt: Wie sich die Produktion verändert, hängt stark davon ab, wie sich das Konsumentenverhalten entwickelt.»
Der Blick auf das Gesamtsystem ist gut und wichtig. Er sollte aber nicht dazu dienen, die Verantwortung und den Spielraum kleinzureden, den man selber hat. Die Verantwortung für die Umwelt und der Spielraum sind bei der Agrarpolitik besonders hoch. (Vision Landwirtschaft)
(gb)
FORSCHUNG: Politik fördert Ernährungsstile unterschiedlich
Vision Landwirtschaft hat in einer Studie untersuchen lassen, wie die Politik sieben verschiedene Ernährungsstile – von «vegan» bis «fleischbetont» – indirekt unterstützt. Fazit: Die Nahrungsmittel der verschiedenen Ernährungsstile werden sehr ungleich unterstützt. Per Saldo werden mehrere hundert Franken pro Person und Jahr von «veganen» und «umweltoptimierten» zu «protein- und fleischbetonten» Ernährungsstilen umverteilt.
Vor zwei Jahren hat der Verein Vision Landwirtschaft, eine Denkwerkstatt unabhängiger Landwirtschaftsexperten, die Kosten (Vollkosten) und Kostenträger (Konsument:innen, Steuerzahler:innen, Allgemeinheit) der Schweizer Nahrungsmittel beziffert. Es zeigte sich: Verursachergerechtigkeit oder Kostenwahrheit liegen in weiter Ferne, auch im Vergleich mit anderen Politikbereichen.
Nach weiteren Temperatur-Rekorden bleibt das Thema Ernährung aktuell. Immer öfter hört man, dass der Schlüssel zur Lösung von Umweltproblemen bei Ernährungsstilen zu suchen ist. Kürzlich hat auch der Direktor des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) darauf hingewiesen. Was tut die Agrarpolitik in dieser Hinsicht?
In einer neuen Studie hat Vision Landwirtschaft untersucht, wie die Politik verschiedene Konsumstile finanziell unterstützt oder belastet – anregt oder entmutigt. Berücksichtigt wurden wie schon in der Studie von 2020 die Beiträge des Bundes für die Nahrungsmittelproduktion und die ungedeckten Kosten zulasten der Allgemeinheit (externe Kosten von Umweltauswirkungen der Produktion).
Die Berechnungen wurden von der Basler Beratungsfirma BSS im Auftrag von Vision Landwirtschaft durchgeführt und von der Kalaidos Fachhochschule Schweiz begleitet. Datengrundlage sind Ökobilanzzahlen für Nahrungsmittel und Ernährungsstile der Firma ESU-Services und (aktualisierte) Kostenschätzungen der Studie «Kosten und Finanzierung der Landwirtschaft» von Vision Landwirtschaft.
Verglichen wurden die indirekten Kosten von sieben Ernährungsstilen:
●vegan keine tierischen Produkte)
●ovo-lacto-vegetarisch (nur pflanzliche Nahrungsmittel, Eier, Honig, Milchprodukte)
●ovo-lacto-pescetarisch (nur pflanzliche Nahrungsmittel, Eier, Honig, Milchprodukte, Fisch)
●flexitarisch (gemässigter Fleischkonsum, Milchprodukte, Eier)
●proteinbetont (hoher Konsum von Fleisch, Milchprodukten und Eiern)
●fleischbetont (sehr hoher Fleischkonsum)
●umweltoptimiert (basierend auf der Schweizer Lebensmittelpyramide und Empfehlungen zum nachhaltigen Essen und Trinken FOODprints®)
Beiträge der Steuerzahlenden und Umweltkosten
Die Beiträge des Bundes an die Nahrungsmittelproduktion betrugen im Jahr 2020 rund 300 Franken pro Person. Im diesem Umfang wurden also die durchschnittlich konsumierten Nahrungsmittel unterstützt. In die Nahrungsmittel des veganen Ernährungsstils flossen pro Person und Jahr rund 50 Franken. Demgegenüber flossen 500 Franken pro Person in die Nahrungsmittel der Ernährungsstile «proteinbetont» und «fleischbetont» (Abbildung, hellgelber Bereich der Balken).
Die von der Politik in Kauf genommenen und nicht den Verursachern angelasteten Kosten zulasten der Allgemeinheit (externe Kosten) beliefen sich im Jahr 2020 auf durchschnittlich 800 Franken pro Person. Dabei wiesen die Ernährungsstile «umweltoptimiert» und «vegan» mit 450 bzw. 500 Franken pro Person die tiefsten, die Ernährungsstile «proteinbetont» und «fleischbetont» mit je 1050 Franken die höchsten externen Kosten auf.
Wenn beim Fleisch auch bescheidene (Hackfleisch, Innereien) und weniger bescheidene Ernährungsstile (hochpreisige Fleischstücke) unterschieden werden, gehen die Zahlen noch stärker auseinander. Am stärksten gefördert wurden– wenig erstaunlich – luxuriöse fleisch- betonte Ernährungsstile mit Beiträgen pro Person im Jahr 2020 im Bereich von 2500 Franken.
Weitergehende Berechnungen zeigen auf, wie in der Schweiz über Nahrungsmittelsubventionen indirekt Einkommen umverteilt werden – wie viel also per Saldo beispielsweise von veganen hin zu fleischbetonten Ernährungsstilen umverteilt wird.
Blick auf das Gesamtsystem
Heute wird im Zusammenhang mit der Agrarpolitik gerne auf das Gesamtsystem verwiesen. Die Umweltkosten der Landwirtschaft werden dabei zum Problem der Konsumentinnen und Konsumenten gemacht. So auch in einem Interview des Tagesanzeigers mit Christan Hofer, Direktor des Bundesamts für Landwirtschaft.
Tagesanzeiger: Wie wollen Sie die Landwirtschaft dazu bringen, weniger tierische und dafür mehr menschliche Nahrungsmittel zu produzieren? BLW-Direktor Christian Hofer: Die Veränderung wird über die Nachfrage kommen – der Konsum muss sich in erster Linie ändern. […] Wenn wir die Tierproduktion in der Schweiz herunterfahren, importieren wir einfach mehr und exportieren die Emissionen. Diese Erzählung kennen wir auch von den Lobbyisten der Agrarindustrie. Sie ist in hohem Mass irreführend. Die Zahlen zeigen: Die Massnahmen des Bundes behindern die Entwicklung hin zu nachhaltigeren Ernährungsstilen. Trotz allen schönen Worten: der Bund sorgt weiterhin dafür, dass diejenigen, die sich um eine nachhaltige Ernährung bemühen, finanziell benachteiligt werden.
Bevorzugte und weniger bevorzugte Ernährungsweisen
Die Politik wirkt dabei nicht nur über die Preise, sondern auch subtiler, auf psychologischer und moralischer Ebene. Der Bund macht mit seinen Fleisch- und Tiersubventionen und Werbung für «Schweizer Fleisch» eine Rundum-Versorgung für fleischbetonte Ernährung: Er sorgt für tiefe Preise, ein gutes Gewissen und patriotisch gefärbte staatliche Anerkennung. Die Aussage: «Wenn wir die Tierproduktion in der Schweiz herunterfahren, importieren wir einfach mehr und exportieren die Emissionen», ist deshalb höchstens halbwahr.
Die Werbung für «Schweizer Fleisch» ist der beste Beleg dafür. Diese Werbung ist nur rational zu erklären, wenn das «gute Gewissen» den Fleischkonsum insgesamt fördert. Warum lässt sich das sagen? Weil die Anteile Fleisch aus dem In- und Ausland nicht von der Wahl der Konsumentinnen und Konsumenten abhängen, sondern vom Gesamtkonsum. Dafür sorgen die Importkontingente. Wenn man die Produktion von Schweizer Fleisch steigern will, muss man den Konsum von Fleisch insgesamt steigern. Genau das macht die Werbung mit dem guten Gewissen. Die Werber zielen auf eine Stärkung der Nachfrage nach Fleisch insgesamt – anders als Proviande und der Bundesrat uns glauben machen wollen.
Zudem würden die Emissionen auch bei gleichbleibendem Konsum nur teilweise exportiert, aus zwei Gründen: Erstens, weil die Produktion in der Schweiz bereits intensiver und deshalb – insbesondere bei den Umweltbelastungen mit Stickstoff – umweltschädlicher ist als in vielen Herkunftsländern von Importen. Zweitens, weil die Schweiz weit dichter besiedelt ist. Die Umweltkosten zusätzlicher Produktion sind in der Schweiz deshalb besonders hoch. Auch die frühere Einsicht, dass der Selbstversorgungsgrad kein gutes Mass für Versorgungssicherheit ist, ging beim BLW wieder vergessen.
Zum Schluss noch einmal Christian Hofer: «Wir prüfen derzeit, ob es in der heutigen Agrarpolitik immer noch Fehlanreize gibt. […] Aber wie bereits gesagt: Wie sich die Produktion verändert, hängt stark davon ab, wie sich das Konsumentenverhalten entwickelt.»
Der Blick auf das Gesamtsystem ist gut und wichtig. Er sollte aber nicht dazu dienen, die Verantwortung und den Spielraum kleinzureden, den man selber hat. Die Verantwortung für die Umwelt und der Spielraum sind bei der Agrarpolitik besonders hoch. (Vision Landwirtschaft)
(gb)
News, Tipps, … – die neuesten Beiträge
Ecke für Profis
26.06.2025
.TECHNOLOGIE: Chatbots für Kreativ-Anwendungen

KI-Bots eignen sich gut für Rezept-Entwicklungen und Produktkreationen. Aber bei Recherchen gilt: Roboter sind auch nur Menschen.
.TECHNOLOGIE: Chatbots für Kreativ-Anwendungen

KI-Bots eignen sich gut für Rezept-Entwicklungen und Produktkreationen. Aber bei Recherchen gilt: Roboter sind auch nur Menschen.